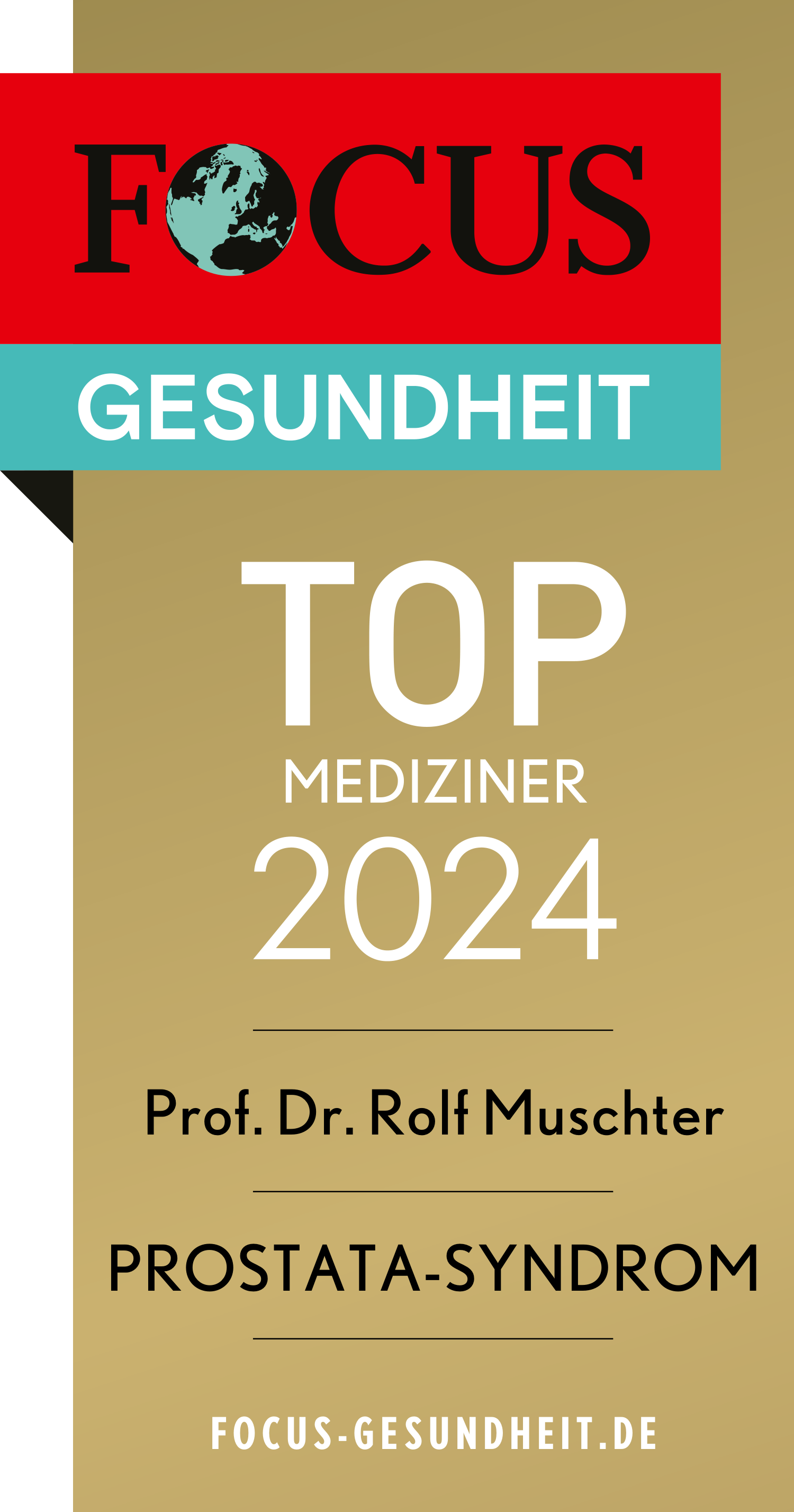Schilddrüse aus der Balance: Diese Symptome sind typisch
Die Schilddrüse ist ein kleines, schmetterlingsförmiges Organ im vorderen Halsbereich, das eine große Rolle für den Stoffwechsel, das Wachstum und zahlreiche Körperfunktionen spielt. Gerät sie aus dem Gleichgewicht, kann das weitreichende Auswirkungen auf den gesamten Körper haben. Doch welche Symptome sind typisch für eine Schilddrüsenfehlfunktion? In diesem Artikel erfährst Du alles Wichtige über Über- und Unterfunktion der Schilddrüse sowie deren Auswirkungen auf Deine Gesundheit.
- Schilddrüse aus der Balance: Diese Symptome sind typisch
- Warum ist die Schilddrüse so wichtig?
- Welche Symptome treten bei einer Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) auf?
- Welche Symptome treten bei einer Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) auf?
- Welche weiteren Symptome und Langzeitfolgen gibt es?
- Wie wird eine Schilddrüsenerkrankung erkannt?
- Wie beeinflusst die Schilddrüse das psychische Wohlbefinden?
- Welche Rolle spielt die Schilddrüse in der Schwangerschaft?
- Welche Ernährung unterstützt die Schilddrüsenfunktion?
- Welche Symptome sind typisch für Frauen?
- Welche Symptome sind typisch für Männer?
- Quellen
Auf einen Blick
- Die Schilddrüse steuert viele wichtige Körperfunktionen und beeinflusst Stoffwechsel, Herz-Kreislauf-System und Psyche.
- Eine Überfunktion (Hyperthyreose) führt oft zu Gewichtsverlust, Nervosität und Herzrasen.
- Eine Unterfunktion (Hypothyreose) verursacht Müdigkeit, Gewichtszunahme und depressive Verstimmungen.
- Weitere Symptome sind Haarausfall, trockene Haut, Schlafstörungen und Konzentrationsprobleme.
- Eine rechtzeitige Diagnose durch Bluttests und bildgebende Verfahren ist entscheidend.
- Behandlungsmöglichkeiten umfassen Medikamente, Hormontherapie oder in manchen Fällen eine Operation.
Warum ist die Schilddrüse so wichtig?
Die Schilddrüse produziert die Hormone Thyroxin (T4) und Trijodthyronin (T3), die den gesamten Stoffwechsel steuern. Sie beeinflusst nicht nur das Gewicht, sondern auch die Herzfrequenz, die Körpertemperatur und die geistige Leistungsfähigkeit. Ein Ungleichgewicht dieser Hormone kann daher schwerwiegende Folgen haben.
Welche Symptome treten bei einer Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) auf?
Eine Schilddrüsenüberfunktion entsteht, wenn die Schilddrüse zu viele Hormone produziert. Dies führt zu einer Überaktivierung des Stoffwechsels. Typische Symptome sind:
- Ungewollter Gewichtsverlust, trotz normalem oder sogar gesteigertem Appetit
- Herzrasen (Tachykardie), erhöhter Blutdruck und Herzrhythmusstörungen
- Innere Unruhe, Nervosität und Schlafprobleme
- Schwitzen, Hitzeempfindlichkeit und Zittern der Hände
- Vermehrter Stuhlgang oder Durchfall
- Haarausfall und dünne, brüchige Haare
Die häufigsten Ursachen für eine Hyperthyreose sind Morbus Basedow, eine Autoimmunerkrankung, sowie Schilddrüsenknoten, die unkontrolliert Hormone produzieren.
In einer Studie wurde herausgefunden, dass sowohl eine manifeste als auch eine subklinische Schilddrüsenüberfunktion das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz erhöhen. Deshalb wird empfohlen, Schilddrüsenwerte bei Patienten mit Herzbeschwerden zu überprüfen.
Welche Symptome treten bei einer Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) auf?
Bei einer Unterfunktion der Schilddrüse werden zu wenige Hormone gebildet. Dadurch verlangsamt sich der gesamte Stoffwechsel. Mögliche Symptome sind:
- Müdigkeit, Antriebslosigkeit und depressive Verstimmungen
- Gewichtszunahme, trotz unveränderter Essgewohnheiten
- Trockene Haut, brüchige Nägel und Haarausfall
- Frieren und Kälteempfindlichkeit
- Langsamer Herzschlag (Bradykardie)
- Verdauungsprobleme, insbesondere Verstopfung
Die häufigste Ursache ist eine chronische Autoimmunerkrankung (Hashimoto-Thyreoiditis), bei der das Immunsystem die Schilddrüse angreift. Auch Jodmangel kann langfristig eine Hypothyreose begünstigen.
Welche weiteren Symptome und Langzeitfolgen gibt es?
Ein Schilddrüsenungleichgewicht kann sich zudem durch folgende Beschwerden äußern:
- Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit oder depressive Verstimmungen
- Konzentrations- und Gedächtnisstörungen
- Muskelschwäche oder Muskelkrämpfe
- Schwellungen am Hals (Kropf, Struma)
- Zyklusstörungen oder Fruchtbarkeitsprobleme bei Frauen
Wird eine Schilddrüsenerkrankung nicht behandelt, kann sie langfristig schwerwiegende gesundheitliche Probleme verursachen. Eine unbehandelte Überfunktion kann das Herz schädigen, während eine anhaltende Unterfunktion das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Depressionen erhöht.
Wie wird eine Schilddrüsenerkrankung erkannt?
Die Diagnose erfolgt durch eine Kombination aus Bluttests, Ultraschalluntersuchungen und gegebenenfalls einer Szintigraphie:
- Blutuntersuchung: Bestimmung der TSH-Werte sowie der Schilddrüsenhormone T3 und T4
- Ultraschall: Beurteilung der Schilddrüsengröße und eventueller Knoten
- Szintigraphie: Darstellung der Hormonaktivität innerhalb der Schilddrüse
- Antikörpertest: Zum Nachweis von Autoimmunerkrankungen wie Morbus Basedow oder Hashimoto
Wie beeinflusst die Schilddrüse das psychische Wohlbefinden?
Ein Schilddrüsenungleichgewicht kann nicht nur körperliche Beschwerden verursachen, sondern auch die psychische Gesundheit erheblich beeinträchtigen. Menschen mit einer Überfunktion leiden häufig unter Angstzuständen und Panikattacken, während eine Unterfunktion oft mit Depressionen und Antriebslosigkeit einhergeht. Diese psychischen Symptome werden oft nicht sofort mit der Schilddrüse in Verbindung gebracht, weshalb eine frühzeitige Diagnose umso wichtiger ist.
So wurde auch in einer Studie herausgefunden, dass Schilddrüsenerkrankungen häufig psychische Symptome wie Angstzustände, Depressionen oder Konzentrationsschwierigkeiten verursachen können. Diese klingen in der Regel nach erfolgreicher Behandlung der Schilddrüsenerkrankung ab.
Auch hatte eine weitere Studie ergeben, dass eine Überfunktion der Schilddrüse bei Kindern mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für psychische Erkrankungen in Verbindung gebracht werden kann, darunter ADHS, Anpassungsstörungen, Angststörungen, bipolare Störungen, Depressionen und Suizidalität.
Welche Rolle spielt die Schilddrüse in der Schwangerschaft?
Während der Schwangerschaft ist die Schilddrüsenfunktion besonders wichtig, da sie das Wachstum und die Entwicklung des ungeborenen Kindes beeinflusst. Eine unbehandelte Schilddrüsenunterfunktion kann zu Komplikationen wie Frühgeburten, niedrigem Geburtsgewicht und Entwicklungsstörungen führen. Schwangere sollten daher regelmäßig ihre Schilddrüsenwerte kontrollieren lassen, um Risiken frühzeitig zu erkennen.
Welche Ernährung unterstützt die Schilddrüsenfunktion?
Eine gesunde Ernährung kann die Schilddrüsenfunktion unterstützen. Besonders wichtig sind:
- Jod: Unverzichtbar für die Hormonproduktion, enthalten in Meeresfrüchten, Milchprodukten und jodiertem Speisesalz.
- Selen: Unterstützt die Umwandlung von T4 in das aktive Hormon T3, zu finden in Paranüssen, Fisch und Eiern.
- Zink: Wichtig für die Hormonregulation, enthalten in Fleisch, Hülsenfrüchten und Nüssen.
- Eisen: Essenziell für den Sauerstofftransport, kommt in rotem Fleisch, Spinat und Vollkornprodukten vor.
Eine ausgewogene Ernährung kann helfen, eine optimale Schilddrüsenfunktion zu gewährleisten und das Risiko für Erkrankungen zu minimieren.
Welche Symptome sind typisch für Frauen?
Frauen sind häufiger von Schilddrüsenfehlfunktionen betroffen als Männer, insbesondere von einer Schilddrüsenunterfunktion. Typische Symptome bei Frauen sind:
- Zyklusstörungen: Unregelmäßige, starke oder ausbleibende Menstruation
- Fruchtbarkeitsprobleme: Schwierigkeiten, schwanger zu werden
- Haarausfall und brüchige Nägel: Durch den verlangsamten Stoffwechsel
- Trockene Haut: Ein häufiges Anzeichen einer Unterfunktion
- Gewichtsschwankungen: Oft ungewollte Gewichtszunahme oder plötzlicher Gewichtsverlust
Hormonelle Veränderungen während der Schwangerschaft oder in den Wechseljahren können die Symptome verstärken oder neue Probleme auslösen. Frauen sollten daher ihre Schilddrüsenwerte regelmäßig kontrollieren lassen.
Welche Symptome sind typisch für Männer?
Obwohl Männer seltener von Schilddrüsenerkrankungen betroffen sind, können sie ebenfalls unter Symptomen leiden. Dazu gehören:
- Muskelschwäche und verminderte Leistungsfähigkeit: Besonders bei körperlicher Anstrengung
- Gewichtsveränderungen: Unerwarteter Verlust oder Zunahme
- Haarverlust und frühzeitige Glatzenbildung: Besonders bei einer Überfunktion
- Sexuelle Dysfunktionen: Libidoverlust oder Erektionsstörungen
- Depressive Verstimmungen und Antriebslosigkeit: Besonders bei einer Unterfunktion
Männer neigen dazu, Schilddrüsensymptome zu übersehen oder mit allgemeinem Stress zu verwechseln. Eine frühzeitige Untersuchung kann helfen, langfristige Folgen zu vermeiden.
 Deutsch
Deutsch